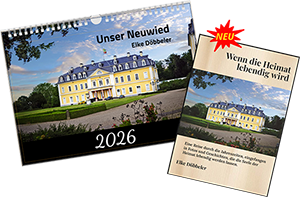Bundesinnenminister Alexander Dobrindt setzt sich dafür ein, junge Menschen in Schulen auf Krisenfälle vorzubereiten. Sein Vorschlag sei, dass in einem Schuljahr in einer Doppelstunde mit älteren Schülern darüber diskutiert werde, welche Bedrohungsszenarien es geben könne und wie man sich darauf vorbereite, Kinder seien wichtige Wissensträger in die Familien hinein. Der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak unterstützt diesen Vorschlag, er halte nämlich nichts davon, solche Themen, von denen jeder wisse, dass es sie gebe, aus den Schulen auszusperren.
Die Frage sei vielmehr, ob es ausreiche, einmal im Jahr darüber zu sprechen, was zu tun sei, wenn hier etwas passiere, denn ob es jetzt die eine Doppelstunde im Jahr sei oder ob man vielleicht regelmäßig auch mal Leute hereinhole, vom Technischen Hilfswerk beispielsweise, die von ihrer Arbeit berichteten, warum sollte das in der Schule nicht stattfinden. Quentin Gärtner von der Bundesschülerkonferenz bezweifelt, dass es wirklich mit einer Doppelstunde einmal im Jahr getan sei. Es sei richtig, jungen Menschen Bedrohungslagen nahezubringen, sagt auch der Lehrerverbandspräsident Stefan Düll. Ich finde den Dobrindt-Vorstoß zur Krisenvorsorge an Schulen bedenkenswert, auch wenn ich die Aktivitäten des Bundesinnenministers ansonsten zumeist kritisch sehe. Aber man sollte schon versuchen, zu Sachlagen unabhängig von der konkreten Person, die etwas vorschlägt, einen Standpunkt zu entwickeln. In Japan etwa wird schon den Kindern beigebracht, dass sie auf wackligem Untergrund leben und wie sie sich im Falle eines Erdbebens verhalten sollen. Und in Großbritannien gehören Übungen für den Katastrophenfall an Schulen zum Alltag.