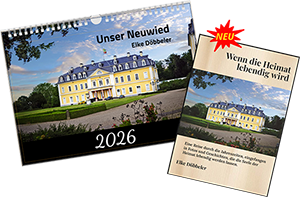Der 27. Januar und die Aktualität der Gedenkkultur
Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee jährt sich am 27. Januar 2025 zum 80. Mal. Dieser Tag ist ein wichtiger Bestandteil der Erinnerungskultur und mahnt, die Verbrechen des Holocaust nie zu vergessen. In ganz Deutschland finden an diesem Tag zahlreiche Veranstaltungen statt – von Gedenkzeremonien über Lesungen, Ausstellungen und Filmvorführungen bis hin zu Diskussionsrunden und Workshops. Die Universität Koblenz startet zudem ein interdisziplinäres Programm, das sich umfassend der Förderung eines respektvollen und demokratischen Dialogs in der Gesellschaft widmet.
Dieses breit angelegte Format zielt darauf ab, gegen radikale und extremistische Tendenzen vorzugehen und das Bewusstsein für die Bedeutung von Toleranz und gesellschaftlichem Zusammenhalt zu stärken. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur die Sensibilisierung der Studierenden und Lehrenden, sondern auch eine gezielte Ansprache der breiteren Öffentlichkeit in diesem Kontext. Durch Workshops, Diskussionsforen und innovative Bildungsansätze sollen sowohl die akademische Gemeinschaft als auch die Gesellschaft für die Gefahr radikaler Stimmen sensibilisiert und zu einem bewussteren Umgang mit demokratischen Werten inspiriert werden.
Der Gedenktag ist also nicht nur ein Rückblick auf die Vergangenheit, sondern auch ein Appell, jeglichem Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung in der Gegenwart entschieden entgegenzutreten. Im Fokus stehen Fragen nach Möglichkeiten der Erneuerung der Erinnerungskultur in einer Zeit wachsender antisemitischer Tendenzen und radikaler Strömungen sowie nach der Verantwortung von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Denn in Zeiten von Fake News, wachsendem Antisemitismus und rechtsextremer Propaganda stehen Institutionen und Projekte vor neuen Herausforderungen.
Dr. Inka Engel, Referentin für Transfer und Wissenschaftskommunikation sowie Projektleiterin des bürgerwissenschaftlichen Projekts „Bürgerwissenschaftliche Erforschung der Familiengeschichte von Einheimischen und Migrant*innen und ihr Verhältnis zur NS-Zeit“ (BEFEM) der Universität Koblenz, erklärt:
„Unsere Arbeit zeigt, dass Erinnerung nicht statisch sein darf. Sie muss sich immer wieder neu an gesellschaftliche Realitäten anpassen. Mit BEFEM erforschten wir, wie Familiengeschichten – sowohl von Einheimischen als auch von Migrant*innen – mit der NS-Geschichte verbunden sind. Dabei nutzen wir Ansätze wie empathiebasierte Rassismusprävention, um Erinnerungskultur als Werkzeug gegen Ausgrenzung und Hass zu stärken.“
Prof. Dr. Christian Geulen, Experte für Neuere und Neuste Geschichte mit Schwerpunkten auf Rassismus, Nationalismus und Kolonialismus an der Universität Koblenz, betont: „Die Erinnerung an den Holocaust ist nicht nur eine historische Pflicht, sondern auch ein Werkzeug, um gesellschaftliche Mechanismen von Ausgrenzung zu verstehen. Wenn wir Antisemitismus und Rassismus in der Gegenwart bekämpfen wollen, müssen wir vor allem jungen Menschen zeigen, wie historische Diskriminierungsformen und heutige Ideologien zusammenhängen.“
Das Projekt BEFEM, das von 2023 bis 2024 vom Landtag Rheinland-Pfalz gefördert wurde, arbeitet daran, Erinnerungsarbeit in den Alltag zu integrieren. Es verbindet die Aufarbeitung persönlicher Familiengeschichten mit historischen Forschungsansätzen und nutzt innovative Methoden, um unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen. Dazu gehören Vorträge, Workshops, die Empathie fördern und Rassismus entschlüsseln, oder auch eine Holocaust-Filmreihe in Kooperation mit dem Kinocenter Odeon-Apollo in Koblenz.
Engel erläutert die Intention: „Wir möchten, dass Erinnerung kein distanziertes 'Damals' bleibt, sondern in das 'Heute' und 'Morgen' wirkt. Nur wenn wir Menschen dazu befähigen, sich emotional mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, können wir ein Bewusstsein für die Konsequenzen von Ausgrenzung und Hass schaffen.“